Im Bereich der Kurzstreckenluftfahrt stehen sich zwei Flugzeugtypen gegenüber, die sich in ihrer Antriebstechnologie und ihren Eigenschaften fundamental unterscheiden: Turboprop-Flugzeuge und Jets. In dieser Abhandlung werden die Vor- und Nachteile beider Konzepte beleuchtet, der Treibstoffverbrauch unter die Lupe genommen und die Gründe für die Präferenz von Jets auf kurzen Strecken erläutert.
Es ist noch gar nicht so lange her, da war es noch fast selbstverständlich, dass beispielsweise zwischen Deutschland und Österreich, besonders auf dezentralen Routen, fast ausschließlich Turbopropflugzeuge eingesetzt werden. Nach und nach sind auch kleine Jets wie Bombardier CRJ200 aufgekommen. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Routen zwischen den beiden Staaten, auf denen regulär Turboprops wie de Havilland Dash 8-400 fliegen. Zumeist wurden die Props von Jets abgelöst. Es gibt aber auch Routen, die gar nicht mehr angeboten werden, weil diese sich im Jetbetrieb schlichtweg nicht rechnen.
Turboprops: Effiziente Kraftpakete für kurze Distanzen
Turboprop-Flugzeuge, auch Propellerflugzeuge genannt, zeichnen sich durch ihre charakteristischen Propeller aus, die von Gasturbinen angetrieben werden. Diese Technologie überzeugt mit ihrer Einfachheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Turboprops brillieren mit einem geringen Treibstoffverbrauch, der sie prädestiniert für den Einsatz auf kürzeren Strecken macht. Ein weiterer Vorteil liegt in ihrer Fähigkeit, auf unbefestigten Pisten zu starten und zu landen, was ihre Flexibilität im Hinblick auf mögliche Einsatzgebiete erhöht.
Das Starten- und Landen auf Graspisten ist aber nicht mit jedem Turboprop-Flugzeug möglich. Es gibt zahlreiche Modelle, die sehr weit verbreitet sind, die über diese Fähigkeit schlichtweg nicht verfügen, da sie nicht für dieses Segment entwickelt worden sind. Einige Turboprop-Flugzeuge verfügen über so genannte Stol-Fähigkeiten, was vereinfacht gesagt bedeutet, dass diese auch auf sehr kurzen Runways starten und landen können. Je nach Modell ist dies serienmäßig oder ein aufpreispflichtiges Extra. Natürlich gibt es auch Turbopropflugzeuge, die generell über keine Stol-Fähigkeiten verfügen. Es gilt hierzu auch zu erwähnen, dass es auch Stol-fähige Jets gibt, die beispielsweise am London City Airport zum Einsatz kommen. Dieser Airport ist übrigens ein Musterbeispiel dafür, dass Turboprops mittlerweile weitgehend von Jets wie Embraer 170 und Embraer 190 verdrängt wurden.

Jets: Schnelle Flugzeuge für lange Distanzen
Jets hingegen setzen auf die Kraft von Strahltriebwerken, die für ihre hohe Geschwindigkeit und Flughöhe bekannt sind. Sie ermöglichen Nonstop-Verbindungen über weite Distanzen und bieten ein komfortableres Reiseerlebnis mit geringerer Geräuschentwicklung. Allerdings haben Jets auch einen deutlich höheren Treibstoffverbrauch und sind daher im Betrieb teurer.
Allerdings können die höheren Betriebskosten bei entsprechender Nachfrage zu vernachlässigen sein, denn wenn man auf einer Route mit Airbus A320 oder Boeing 737 eine hohe Auslastung bei hohem Yield erzielen kann, ist der Profit gegenüber dem Einsatz kleinerer Maschinen wie ATR72 oder de Havilland Dash 8-400 höher. Diese Rechnung geht aber nicht auf, wenn die Nachfrage so niedrig ist, dass die genannten Turbopropflugzeuge nicht einmal halbvoll werden würden. Der durchschnittliche Ticketpreis müsste dann so enorm hoch sein, dass es unwahrscheinlich ist, dass viele Menschen diese Flüge buchen würden.

Treibstoffverbrauch im Vergleich: Wer ist der Sparfuchs?
Um einen objektiven Vergleich zu ermöglichen, wird der Treibstoffverbrauch pro Passagierkilometer einiger ausgewählter Flugzeugmodelle verglichen:
- Embraer 170 (Jet): 0,075 Liter/Passagierkilometer
- Bombardier CRJ700 (Jet): 0,081 Liter/Passagierkilometer
- ATR42 (Turboprop): 0,048 Liter/Passagierkilometer
- ATR72 (Turboprop): 0,040 Liter/Passagierkilometer
- de Havilland Dash 8-400 (Turboprop): 0,043 Liter/Passagierkilometer
- Airbus A220-100 (Jet): 0,035 Liter/Passagierkilometer
Deutlich wird, dass Turboprops wie die ATR72 und der Dash 8-400 in puncto Treibstoffeffizienz die Nase vorn haben. Jets wie der Airbus A220-100, der allerdings auch für längere Strecken ausgelegt ist, können mithalten und sogar punktuell günstiger sein. Das bedeutet konkret, dass es auf individuelle Gegebenheiten der jeweiligen Route ankommt, denn die Auslastung und die Ticketeinnahmen spielen dabei eine sehr bedeutende Rolle. Die genannten Angaben zum Treibstoffverbrauch basieren auf Angaben der jeweiligen Hersteller. Der tatsächliche Verbrauch ist von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise Zuladung (Passagiere, Gepäck und ggfs. Fracht) sowie Gegenwind abhängig. Daher sind die Werte lediglich als Richtwerte zu betrachten.

Warum setzen Airlines auf Jets für kurze Strecken?
Trotz der Vorteile von Turboprops im Bereich des Treibstoffverbrauchs entscheiden sich Airlines häufig für Jets, auch auf kurzen Strecken. Die Gründe dafür sind vielfältig:
- Höhere Geschwindigkeit: Jets bieten deutlich kürzere Flugzeiten, was für Geschäftsreisende und Urlauber gleichermaßen attraktiv ist.
- Größere Reichweite: Jets können längere Strecken ohne Zwischenlandung zurücklegen, was die Flexibilität im Flugplan erhöht.
- Komfort: Jets bieten im Vergleich zu Turboprops eine leisere und komfortablere Kabine mit mehr Beinfreiheit.
- Marketing: Jets gelten als prestigeträchtiger und vermitteln ein Image von Luxus und Exklusivität.
Ein Faktor, der nicht außer Acht gelassen werden sollte: Viele Passagiere, gerade Wenigflieger, empfinden Turbopropflugzeuge als “veraltet”. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um den Erstflug handelt oder ob die Maschine tatsächlich schon 25 Jahre auf dem Buckel hat. Das wissen Entscheidungsträger großer Airlines sehr genau und dieses subjektive Empfinden hat auch dazu beigetragen, dass sich die Lufthansa Group schrittweise von der Turbopropflotte, die vormals von konzerneigenen Carriern wie Austrian Airlines, Air Dolomiti, Eurowings oder Subunternehmern wie Augsburg Airways betrieben wurden, getrennt hat. Dadurch ist es zur Ausdünnung von Frequenzen und Destinationen gekommen, da beispielsweise der Maschinentyp Embraer 190/195 nicht auf jeder Route, die vormals zum Beispiel mit ATR42 oder de Havilland Dash 8-400 bedient wurde, kostendeckend bzw. gewinnbringend betrieben werden kann.

Wartung: Turboprops im Wartungsvorteil?
Sollten Turboprops aufgrund ihrer einfacheren Technologie also auch wartungsfreundlicher sein? Nicht ganz. Tatsächlich erfordern Turboprops aufgrund der mechanischen Komponenten ihrer Propellerantriebe eine häufigere und intensivere Wartung als Jets. Die Wartungsintervalle sind kürzer und die Kosten für Ersatzteile und Inspektionen können höher sein. Hierbei ist de Havilland Dash 8-400 hervorzuheben, denn dieser Maschinentyp benötigt viel „Liebe von Technikern“, um stets zuverlässig in der Luft zu sein.
Zu Beginn der Einflottung der Dash 8-400 bei der Luftfahrtgesellschaft Walter – im Auftrag von Air Berlin – ist es zu besonders vielen AOGs gekommen. Dies hing damit zusammen, dass die Verantwortlichen bei der damals zweitgrößten Airline Deutschlands unterschätzt hatten, dass die Dash 8-400 häufigere Line-Maintenance-Intervalle hat als die vormals in diesem Segment von Germania betriebene Fokker 100. Es handelte sich also um eine Art Lernprozess, der jedoch dazu führte, dass dieses Muster dann zuverlässig und mit wenig AOGs betrieben werden konnte. Dies setzte sich anschließend im Auftrag von Eurowings fort, jedoch musste LGW zu Beginn der Corona-Pandemie Insolvenz anmelden.

Die Wahl des richtigen Flugzeugs
Die Entscheidung zwischen Turboprop und Jet für Kurzstreckenflüge ist komplex und hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Airlines müssen die Bedürfnisse ihrer Passagiere, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs und die Routenstruktur berücksichtigen. Turboprops punkten mit Treibstoffeffizienz und Flexibilität auf kurzen Pisten, während Jets mit Geschwindigkeit, Komfort und Reichweite überzeugen. Letztendlich entscheidet die richtige Balance dieser Faktoren über den Sieger im Duell der Giganten.
Das Hauptkriterium für die Auswahl des Maschinentyps sollte aus wirtschaftlichen Gründen stets die Nachfrage kombiniert mit den Ticketerlösen sein. Es gibt zahlreiche Beispiele für kurze Flüge, auf denen Langstreckengerät eingesetzt wird, da so viele Menschen reisen wollen. Als Beispiel hierfür sind einige Inlandsrouten innerhalb Japans zu nennen. Dem gegenüber steht, dass es auch Strecken gibt, auf denen oftmals nur eine einstellige Anzahl von Passagieren an Bord sind. Point-to-Point sind derartige Flüge zumeist unwirtschaftlich, jedoch wollen Airlines auf die Reisenden, die zumeist Umsteiger auf Langstreckenflüge sind, nicht verzichten. In der jüngeren Vergangenheit hat sich aber gezeigt, dass beispielsweise Lufthansa Prioritäten setzt und dann doch auf Zubringerflüge ab bestimmten Regionalflughäfen verzichtet, da man das Fluggerät auf anderen Routen profitabler einsetzen kann.
Waren einst Turbopropflugzeuge auf Regionalstrecken alltäglich anzutreffen, so findet seit ungefähr der 1990er-Jahre eine Umschichtung statt. Diese wurde auch, aber nicht ausschließlich, von Lowcost-Carriern beflügelt. Ging der Trend zunächst weg von Turboprops hin zu kleinen Jets, so setzen Netzwerkcarrier mittlerweile verstärkt auf größeres Fluggerät. Dies hat auch Folgen für kleinere Airports, denn nicht jede Route lässt sich beispielsweise mit Airbus A320 profitabel betreiben. Als Beispiele hierfür sind zu nennen: Die einst von Austrian Airlines betriebenen Strecken ab Graz nach Stuttgart sowie ab Linz nach Düsseldorf wurden an die Konzernschwester Eurowings übergeben. Während die AUA mit de Havilland Dash 8-400 profitabel fliegen konnte, ist das Eurowings mit Airbus-Jets nicht gelungen, da die Nachfrage nicht entsprechend groß war. Die Konsequenz: Die Routen wurden eingestellt. In Linz gibt es zwar noch zwei wöchentliche von Skyalps betriebene Düsseldorf-Umläufe, jedoch keine Tagesrandverbindung mehr. An Hand dieser Beispiele zeigt sich, dass es keinesfalls selbstverständlich ist, dass der Einsatz größerer Maschinen dazu führt, dass mehr Passagiere reisen und schon gleich gar nicht, dass Jets immer die erste Wahl sind.








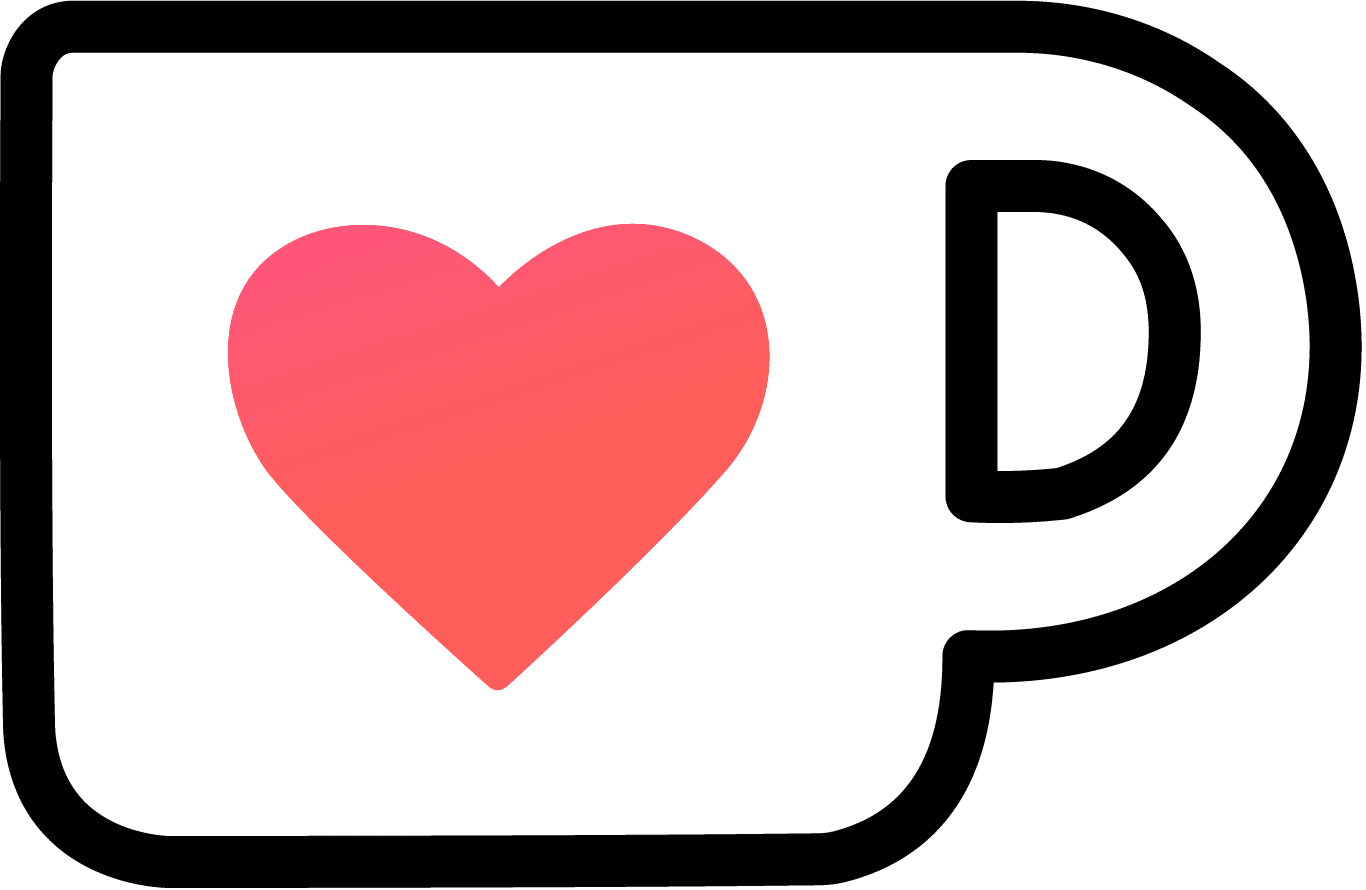 einladen
einladen
1 Comment